Ein Fenster in die Ewigkeit
Raul Brandãos klassischer Roman über die portugiesischen Fischer erstmals in deutscher Sprache
Von Bernhard Malkmus *
Das Meer war schon immer das Ostinato der portugiesischen Wortkunst: Vom Nationalepos Os Lusiades des Luís de Camões über die patriotischen Gesänge Fernando Pessoas ("Oh salziges Meer, wie viel von deinem Salz / Sind Tränen Portugals") bis hin zum "Zyklus des Wassers (erweitertes sonett für allen ginsberg)" von E. M. de Melo e Castro gibt der eiserne Gebieter im Westen dem Land am Rande Europas den Rhythmus vor. Im Verlaufe der langen Jahrhunderte haben Dichter der atlantischen Brandung reiche Obertonreihen abgelauscht: Ob als Ort der Selbstbehauptung des Ich oder der Selbstfindung der Nation, als vermeintlicher Garant der Autarkie Portugals oder Projektionsfläche für geheime seelische Bedürfnisse - die See war und ist für Portugal produktivster Metaphernspender.
Ein Hymnus auf das Meer, der selbst für die portugiesische Literatur einzigartige Züge trägt, liegt nun auch auf Deutsch vor: Raul Brandãos Roman Die Fischer. Im Jahre 1923 erschienen, vereinigt das Buch formbewusst zahlreiche Stilexperimente der zeitgenössischen literarischen Szene mit einer realistischen Grundierung und gewinnt dadurch eine schwebende Durchsichtigkeit, die so manch anderem Werk der portugiesischen klassischen Moderne abgeht. Die Sprache: einfach, kraftvoll, dennoch leichtfüßig. Das Thema: der Mensch und das Meer. Ort des Geschehens: die portugiesische Atlantikküste von der nördlichsten Provinz Minho bis zum südlichen Algarve. Daraus macht Brandão "Skizzen, die wie bestimmte Freilichtmalereien besser sind, wenn sie unvollendet bleiben." Der Leser findet hier also Naturschilderungen, Momentaufnahmen sozialen Lebens, ästhetische Impressionen, anderthalb Dutzend an der Zahl. Er folgt dem Erzähler auf seiner Reise von Norden nach Süden und hat teil an dessen Assoziations- und Erinnerungsreichtum.
Ein kraftvolles Thema mit unerschöpflichen Variationen: Blau - Gold - Grün: Meer - Sand - Land: daraus ist fast alles in dem Buch gewebt. Die entfesselten und besänftigten Elemente, die Früchte des harten Fischerhandwerks, die Verlustbilanzen der Erniedrigten und Beleidigten, vor allem der Frauen: Mann - Kind - Enkel, viele werden Opfer der Fluten. Und dennoch immer wieder, trotzig, zornig, zart - der Blick hinaus: Blau - Gold - Grün: einfach - brutal - lebendig.
"Die Welt, die es nicht mehr gibt, ist meine Welt", meint der Erzähler zu Beginn seiner Exkursion durch die Landschaften der Erinnerung, Schönheit und Lebenswirklichkeit. "Unbedeutende Ereignisse" hätten ihren unauslöschlichen Eindruck auf seiner Netzhaut und in seiner Seele hinterlassen. Und die stellt er nun wieder in den lichtdurchfluteten Raum seiner erzählerischen Trauerarbeit, deren Scheitern er von Anbeginn unumwunden einräumt: "Das Leben ist von einem Zauber, der nicht wiederkehrt." Dennoch hört der Fischersohn Raul Brandão nicht auf, diesen Zauber einzufangen, im Blick der Menschen, in seinen verinnerlichten Landschaften, in der visionären Reduktion der Eindrücke. In Passagen lichtmystischer Begeisterung, die aber stets stoisch gebändigt wirken, wird eine Welt des Übergangs eingefangen - zwischen Irdischem und Überirdischem, Begrenztem und Entgrenztem. Diese Schwelle ist der Ort eines ständig tobenden Lebenskampfes und gleichzeitig von einer Stille wie das Auge des Hurrikans: "Die Welt gibt es nicht - die Welt ist das Licht." An solchen Stellen schimmert eine pantheistische Religiosität durch, die auch die christlichen Mysterien als Bestandteil eines Naturzusammenhangs begreift.
Die einzigartige wechselseitige Durchdringung von realistischer Detailschilderung und symbolistischer Überhöhung bewahrt den Roman weitgehend vor sentimentalen und rein beschreibenden Zügen: "Diese weitläufigen Sandbänke, die manchmal mit dem Filzkraut übersät sind, das die Dünen befestigt, sammeln sich das ganze Jahr über, um im August aus der Trockenheit und dem bitteren Salz eine duftende weiße Lilie hervorzubringen, die ein paar Stunden blüht und dann wieder verschwindet." Solche Momente des Aufscheinens einer anderen Welt hinter der wahrnehmbaren Wirklichkeit durchziehen den gesamten Text und geben ihm sein besonderes Gepräge. Es sind Momente des Erahnens, der Offenbarung, der Epiphanie. Für den Wortkünstler sind es die eigentlichen Gravitationszentren des Schaffens. Hier steht Brandão fest in der Tradition des europäischen Modernismus, in die er sich 1917 mit seinem experimentellen Werk Humús bereits fest eingeschrieben hatte.
Diese literarische Verwurzelung äußert sich auch in Brandãos Bestreben, die Erzählerposition zu profilieren, wie etwa in folgender ironischer Episode: "So leben diese Menschen. Wie sie sterben, das sagte weit besser, als ich es könnte, der alte Friedhof von Póvoa, den es nicht mehr gibt. Man ging langsam von Grab zu Grab und las auf jedem: António Libó, auf See gestorben..." Und dann nimmt der Erzähler den Leser an die Hand und führt ihn durch einen Friedhof, der nicht mehr existiert, der nur durch die Erinnerungsleistung des Dichters wieder zum Leben erweckt wird. Bescheidenheitstopos hin oder her: Dichter bleiben Verdichtungskünstler kultureller Erinnerung - und als solcher begreift sich Brandão, wenn er den Gesang einer Bevölkerung an der Schwelle zum Jenseits und zur Moderne anstimmt: "Meine Toten werden immer lebendiger."
Zwei Nachbarkünste zur Dichtkunst, die Bühnenkunst und die Malerei, durchziehen den Text leitmotivisch. Brandão - so will er uns in gespielter Bescheidenheit mitteilen - sei nämlich eigentlich Bühnenbildner, wäre gerne großer Maler, habe es aber nur zu einem Wortschmied gebracht. Als solcher spielt er ein Spiel von Distanz und Nähe, als Beobachter "völlig abseits der Wirklichkeit" und Beteiligter an den sozialen Fragen seiner Umgebung, als Ästhet und Ethnograph seines eigenen Milieus. Im Zentrum steht das Leben als ein ständiger Vorgang der Verwandlung. Diese archetypische Situation verdichtet sich bei ihm an bestimmten Stellen, wenn die beiden Blicke zusammenfallen, dann ist der Künstler vom Ethnographen nicht mehr zu unterscheiden: "Dort ein Mann am Bug eines schlanken Bootes, er schleudert die Harpune, die Petarda, um eine Flunder im sandigen Grund oder einen Aal zu stechen, der sich im Schlamm verbirgt. Nichts. Aber an der dunklen Gestalt, an der nüchternen Geste gibt es nicht einen Strich zu verbessern."
Nur an wenigen Stellen schleicht sich ein gewisser Hang zur Sozialromantik ein, der aber rasch wieder von der Klarheit der Darstellung in die Schranken gewiesen wird. Die Zivilisationskritik ist stellenweise sogar harsch und bitter: "Ich selbst habe viele Male gesehen, wie die Dampfschiffe säckeweise noch nicht ausgewachsenen Fisch wegwarfen, den das feinmaschige Netz vom Grund mitgeschleift hatte. So schaffte man es, eine Gemeinschaft zu zerstören, die sich selbst ernährte und einen eigenen Charakter besaß." Bemerkenswert auch das Preislied auf Mut und Ausdauer und Zärtlichkeit der Frau im Überlebenskampf. Die Begriffe der Ursprünglichkeit und Unschuld, die dabei gelegentlich untergemischt werden, tragen leicht pathetische Züge, doch insgesamt zeigt sich Brandão in diesem weniger experimentellen und radikalen Werk auch weniger anfällig für stilistische Brüche und visionäre Anwandlungen als in früheren Werken.
Prophetisch und visionär gibt sich das Buch aber stellenweise doch, wenn man die aktuellen Bilder des Massentourismus, des ökologischen Raubbaus und der Landflucht vor Augen hat: "Leb wohl, Olhão, ach Heimat / von Wiesen rings umwachsen / für Fremde bist du Mutter, / Stiefmutter deinen Kindern." Womöglich ist ja auch die vielzitierte portugiesische Melancholie, der Brandãos Humorlosigkeit einiges schuldet, Folge dieser elementaren Erfahrung, dieser Lektion des Meeres: dass man zuhause immer auch Ausgestoßener ist und im Nichts, draußen zwischen Himmel und Horizont, dieses eine doch immer wieder finden mag: Heimat.
Raul Brandão: Die Fischer. Roman. Aus dem Portugiesischen von Astrid Schoregge und Sven Limbeck. Elfenbein Verlag, Heidelberg 2001. 232 Seiten.

|
| Portugal-Post Nr. 28 / 2004 |

|
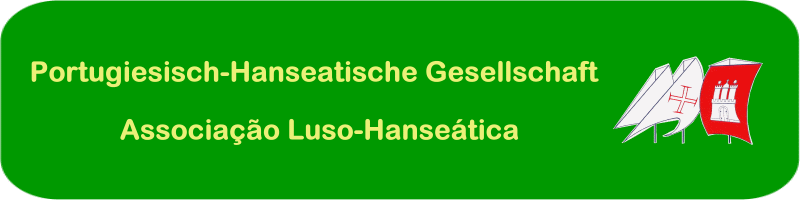 .
.