A doença da serra
Durch die Bergwelt Portugals (3.Teil)
Von Rudolf Malkmus *
![]() Die Fortsetzung unserer Wanderschaft am nächsten Morgen wäre einer Beleidigung der Dorfgemeinschaft gleichgekommen. Jeder hatte uns etwas zu zeigen: der eine einen selbstgebauten Käfig mit einer selbsterjagten Wachtel, der andere die abgelegenen Ruinen einer romanischen Einsiedelei am Rande des Bergwaldes, jener seine Ziegenherde mit lauter durch Namen geadelten Individuen – wie er sich vor Freude auf die Schenkel klatschte, wenn wir Cabrito nicht mehr mit Joana verwechselten! – und ein kleiner Knirps konnte uns nicht oft genug seinen «avô» (Großvater) präsentieren. Besonders herzlich zugetan war uns jedoch Luísa, eine heftig pubertierende Dorfschönheit, die uns errötend immer wieder ihr Herzblatt entgegentrug – ein überaus niedliches, kaum fünf Tage altes Kälbchen. Das alles lässt sich an einem Tage nicht bewältigen. Dass aber daraus eine ganze Woche werden würde, hatten wir doch nicht geahnt.
Die Fortsetzung unserer Wanderschaft am nächsten Morgen wäre einer Beleidigung der Dorfgemeinschaft gleichgekommen. Jeder hatte uns etwas zu zeigen: der eine einen selbstgebauten Käfig mit einer selbsterjagten Wachtel, der andere die abgelegenen Ruinen einer romanischen Einsiedelei am Rande des Bergwaldes, jener seine Ziegenherde mit lauter durch Namen geadelten Individuen – wie er sich vor Freude auf die Schenkel klatschte, wenn wir Cabrito nicht mehr mit Joana verwechselten! – und ein kleiner Knirps konnte uns nicht oft genug seinen «avô» (Großvater) präsentieren. Besonders herzlich zugetan war uns jedoch Luísa, eine heftig pubertierende Dorfschönheit, die uns errötend immer wieder ihr Herzblatt entgegentrug – ein überaus niedliches, kaum fünf Tage altes Kälbchen. Das alles lässt sich an einem Tage nicht bewältigen. Dass aber daraus eine ganze Woche werden würde, hatten wir doch nicht geahnt.
![]() Was war da auch alles zu sehen! Morgens spannte António seine schnaubenden Barrosaner Ochsen, die einander mit ihren riesigen lyraförmigen Hörnern noch rasch einige krachende Hiebe versetzten, in ein roh geschnitztes Holzjoch und zog mit uns auf einem Karren mit Vollscheibenrädern auf die Felder hinaus. Bald sackten wir in morastige Löcher, bald schleiften wir knirschend durch Karrenrillen, die in vielen Jahrhunderten in die Felsplatten eingeschrammt worden waren. Das grausige, nervenzersägende Quietschen der kaum geölten Achsen hat dem Gefährt bei Spaßvögeln den Namen „Lusitanische Nachtigall“ eingetragen.
Was war da auch alles zu sehen! Morgens spannte António seine schnaubenden Barrosaner Ochsen, die einander mit ihren riesigen lyraförmigen Hörnern noch rasch einige krachende Hiebe versetzten, in ein roh geschnitztes Holzjoch und zog mit uns auf einem Karren mit Vollscheibenrädern auf die Felder hinaus. Bald sackten wir in morastige Löcher, bald schleiften wir knirschend durch Karrenrillen, die in vielen Jahrhunderten in die Felsplatten eingeschrammt worden waren. Das grausige, nervenzersägende Quietschen der kaum geölten Achsen hat dem Gefährt bei Spaßvögeln den Namen „Lusitanische Nachtigall“ eingetragen.
![]() Von einem Felskopf aus überblicken wir die weiten, mit Steinmauern begrenzten Feldpolygone, die das Bergnest einfassen; alles umgeben von der Bergheide der Hirten: Allmende, wie das Wasser der Bäche und Brunnen, wie das Holz der Talwälder, der Fels zum Bau der Häuser. Die alte westgotische Wirtschaftsform des «comunitarismo» – die gesamte Dorfgemeinschaft bewirtschaftet gemeinsarn die Felder, um den Ernteertrag der Sippengröße entsprechen zu verteilen – mit der sie über tausend Jahre lang in dieser rauhen Berglandschaft überlebten, zerfällt heute zunehmend. Denn unaufhaltsam dringen die Lebensformen der modernen Industrienationen in dieses uralte pastorale Ordnungsgefüge ein. Die Träger dieses Wandels sind die rückkehrenden Gastarbeiter, die Massenmedien, das Auto und der Ausbau eines Straßennetzes mit Hilfe von EU-Geldern. Viele abgelegene Bergdörfer sind zu Geistersiedlungen geworden, trostlose Ruinenstätten, in denen nur noch einige Greise mit ihrer Vergangenheit hausen. Die Jugend drängt in die Küstenstädte und ins Ausland.
Von einem Felskopf aus überblicken wir die weiten, mit Steinmauern begrenzten Feldpolygone, die das Bergnest einfassen; alles umgeben von der Bergheide der Hirten: Allmende, wie das Wasser der Bäche und Brunnen, wie das Holz der Talwälder, der Fels zum Bau der Häuser. Die alte westgotische Wirtschaftsform des «comunitarismo» – die gesamte Dorfgemeinschaft bewirtschaftet gemeinsarn die Felder, um den Ernteertrag der Sippengröße entsprechen zu verteilen – mit der sie über tausend Jahre lang in dieser rauhen Berglandschaft überlebten, zerfällt heute zunehmend. Denn unaufhaltsam dringen die Lebensformen der modernen Industrienationen in dieses uralte pastorale Ordnungsgefüge ein. Die Träger dieses Wandels sind die rückkehrenden Gastarbeiter, die Massenmedien, das Auto und der Ausbau eines Straßennetzes mit Hilfe von EU-Geldern. Viele abgelegene Bergdörfer sind zu Geistersiedlungen geworden, trostlose Ruinenstätten, in denen nur noch einige Greise mit ihrer Vergangenheit hausen. Die Jugend drängt in die Küstenstädte und ins Ausland.
![]() Wir folgen einem Steig ins Tal hinab. Der Bach leitet hier noch in zahllosen Seitenkanälen sein Wasser über saftige Rieselwiesen, dreht noch das krachend mahlende Räderwerk einer Maismühle, von den alvercas, den großen Brunnenbecken, klingt das Gekeife und Geschnatter der Wäscherinnen herüber; und am Dorfrand steht noch die Schar hochstelziger galizischer espigueiros (Maisspeicher), in denen die einzelnen Familien ihre Ernte lagern.
Wir folgen einem Steig ins Tal hinab. Der Bach leitet hier noch in zahllosen Seitenkanälen sein Wasser über saftige Rieselwiesen, dreht noch das krachend mahlende Räderwerk einer Maismühle, von den alvercas, den großen Brunnenbecken, klingt das Gekeife und Geschnatter der Wäscherinnen herüber; und am Dorfrand steht noch die Schar hochstelziger galizischer espigueiros (Maisspeicher), in denen die einzelnen Familien ihre Ernte lagern.
![]() In den windgeschützten Nischen eines sonnenwarmen Granitrückens lindern sich in langer Reihe die verwelkten Dorfschönen ihr Rheuma. Uralte, knorrig-runzlige Berggewächse. Eine winkt uns mit ihrem Knotenstock und aus ihrem Antlitz, das so unendlich gefältelt ist wie die Blütenblätter der Felszistrosen, leuchten zwei Augen: «Foi lindo ontem!» Die lebhafte Zustimmung aller Umsitzenden zeigte, dass der gestrige Tanzabend im abwechslungslosen Trott der Jahre ein Erlebnisglanzpunkt war. Bald werden sie gesprächig, legen Spindel und Häkelnadel zur Seite, rücken zu uns heran und fangen an zu erzählen von Gicht und Bronchitis, von ihrem harten, entbehrungsreichen Leben voll Arbeit, Kinderkriegen, Not und Leid; von im Angolakrieg gebliebenen Söhnen, von tragischen Schmugglergeschichten an der nahen Grenze, von Unwettern und Viehseuchen. In diesem Matriarchat ist die Frau criada, Dienerin und Magd.
In den windgeschützten Nischen eines sonnenwarmen Granitrückens lindern sich in langer Reihe die verwelkten Dorfschönen ihr Rheuma. Uralte, knorrig-runzlige Berggewächse. Eine winkt uns mit ihrem Knotenstock und aus ihrem Antlitz, das so unendlich gefältelt ist wie die Blütenblätter der Felszistrosen, leuchten zwei Augen: «Foi lindo ontem!» Die lebhafte Zustimmung aller Umsitzenden zeigte, dass der gestrige Tanzabend im abwechslungslosen Trott der Jahre ein Erlebnisglanzpunkt war. Bald werden sie gesprächig, legen Spindel und Häkelnadel zur Seite, rücken zu uns heran und fangen an zu erzählen von Gicht und Bronchitis, von ihrem harten, entbehrungsreichen Leben voll Arbeit, Kinderkriegen, Not und Leid; von im Angolakrieg gebliebenen Söhnen, von tragischen Schmugglergeschichten an der nahen Grenze, von Unwettern und Viehseuchen. In diesem Matriarchat ist die Frau criada, Dienerin und Magd.
![]() Doch auch Vergnügliches macht die Runde. Als eine ihre längst verwehten Liebesabenteuer mit einem Burschen aus der Nachbarschaft gestenreich preisgibt, rücken sogar die bösen Dorfhunde näher und spitzen die Ohren. Drei Wochen lang wurde sie von ihrem Vater für diese Untat eingesperrt. Aber, so flüstert sie mir hinter vorgehaltener Hand ins Ohr und so, dass es alle hören konnten, ging’s noch, ich würd’s gleich wieder tun. Ach, wie schüttelten sich da die Omas vor Lachen. Taschentücher tupften die Backen ab. Und als wir zum Dank für die hübsche Geschichte der Erzählerin einen zarten beijo auf die Wangen drücken, beginnen wir um den Kreislauf einiger Damen zu bangen.
Doch auch Vergnügliches macht die Runde. Als eine ihre längst verwehten Liebesabenteuer mit einem Burschen aus der Nachbarschaft gestenreich preisgibt, rücken sogar die bösen Dorfhunde näher und spitzen die Ohren. Drei Wochen lang wurde sie von ihrem Vater für diese Untat eingesperrt. Aber, so flüstert sie mir hinter vorgehaltener Hand ins Ohr und so, dass es alle hören konnten, ging’s noch, ich würd’s gleich wieder tun. Ach, wie schüttelten sich da die Omas vor Lachen. Taschentücher tupften die Backen ab. Und als wir zum Dank für die hübsche Geschichte der Erzählerin einen zarten beijo auf die Wangen drücken, beginnen wir um den Kreislauf einiger Damen zu bangen.
![]() Jedes Dorf ist in dieser kargen Natur eine Notgemeinschaft, die nur überleben kann, wenn das Dasein nach strengen Regeln der Anpassung abläuft, wenn strenge Normen eingehalten werden. Was der von Gastfreundschaft überschüttete Wandersmann nur erahnen kann, drückt Miguel Torga, der große Sohn der Transmontaner, so aus: „Sie sind alle Freunde, durch die Freundschaft verbunden, die zwischen derben, ausgenutzten Menschen möglich ist, ohne Gelegenheit zu tieferenAbenteuern des Herzens und des Verstandes. Sklaven einer feindlichen Erde und einer feindlichen Gesellschaft, schlichte, grobe Produktionswerkzeuge in den ungerechten Händen des Lebens. Und jeder ist sofort bereit, den anderen fallen zu lassen, sollte er ihm einen Schluck aus der Quelle oder einen schattigen Rastplatz streitig machen.“
Jedes Dorf ist in dieser kargen Natur eine Notgemeinschaft, die nur überleben kann, wenn das Dasein nach strengen Regeln der Anpassung abläuft, wenn strenge Normen eingehalten werden. Was der von Gastfreundschaft überschüttete Wandersmann nur erahnen kann, drückt Miguel Torga, der große Sohn der Transmontaner, so aus: „Sie sind alle Freunde, durch die Freundschaft verbunden, die zwischen derben, ausgenutzten Menschen möglich ist, ohne Gelegenheit zu tieferenAbenteuern des Herzens und des Verstandes. Sklaven einer feindlichen Erde und einer feindlichen Gesellschaft, schlichte, grobe Produktionswerkzeuge in den ungerechten Händen des Lebens. Und jeder ist sofort bereit, den anderen fallen zu lassen, sollte er ihm einen Schluck aus der Quelle oder einen schattigen Rastplatz streitig machen.“
![]() Schließlich, mit zunehmender Vertrautheit, kam die Zeit, in der man sich über die Ursachen unseres Herumstreifens in den Bergen Klarheit zu verschaffen suchte. Doch so sehr wir uns auch um plausible Erklärungen bemühten, sie schienen kein hinreichendes Begreifen zu vermitteln. Bald wurde unser Zustand als «doença da serra» (Bergkrankheit) diagnostiziert. Das geschah mit lächelnder Nachsicht. Doch entging uns nicht, dass manche Dorfbewohner das Herumlaufen von Fremden in der Allmende mit Argwohn betrachteten. Es war Zeit aufzubrechen.
Schließlich, mit zunehmender Vertrautheit, kam die Zeit, in der man sich über die Ursachen unseres Herumstreifens in den Bergen Klarheit zu verschaffen suchte. Doch so sehr wir uns auch um plausible Erklärungen bemühten, sie schienen kein hinreichendes Begreifen zu vermitteln. Bald wurde unser Zustand als «doença da serra» (Bergkrankheit) diagnostiziert. Das geschah mit lächelnder Nachsicht. Doch entging uns nicht, dass manche Dorfbewohner das Herumlaufen von Fremden in der Allmende mit Argwohn betrachteten. Es war Zeit aufzubrechen.
![]() Irgendwann schlürften wir zum letzten Mal Antónios Caldo-Suppe, aus der die Würze aller Pitõeser Bergkräuter dufteten, irgendwann kraulten wir Abschied nehmend Luísas Kälbchen und ließen uns zum letzten Mal von Josés Wachtel auf den mit Maiskörnern belegten Zehnägeln herumpicken.
Irgendwann schlürften wir zum letzten Mal Antónios Caldo-Suppe, aus der die Würze aller Pitõeser Bergkräuter dufteten, irgendwann kraulten wir Abschied nehmend Luísas Kälbchen und ließen uns zum letzten Mal von Josés Wachtel auf den mit Maiskörnern belegten Zehnägeln herumpicken.
Nationalpark Peneda-Gerês
![]() Vorbei an der aufgelassenen Wolfram-Mine Carris überquerten wir in vielen mühseligen Stunden die weglose Felseinöde des Gerês-Plateaus und erreichten gegen Abend einen fast 100 m hohen kegelförmigen Granitmonolith im Bereich des Borrageiro (1431 m). Das gesamte Gelände wirkt trotz seiner geringen Höhe (maximal 1530 m) infolge der Vegetationsarmut, des bewegten Reliefs, der Schluchteinrisse und bizarren Felsfiguren hochalpin.
Vorbei an der aufgelassenen Wolfram-Mine Carris überquerten wir in vielen mühseligen Stunden die weglose Felseinöde des Gerês-Plateaus und erreichten gegen Abend einen fast 100 m hohen kegelförmigen Granitmonolith im Bereich des Borrageiro (1431 m). Das gesamte Gelände wirkt trotz seiner geringen Höhe (maximal 1530 m) infolge der Vegetationsarmut, des bewegten Reliefs, der Schluchteinrisse und bizarren Felsfiguren hochalpin.
![]() Wir entdeckten unter einer einsamen Huteiche einen aus Felsplatten und Grasplacken zusammengebauten Hirtenunterstand, in den man nur kriechend Einlaß fand, und nahmen ihn zum Nachtlager. Am nächsten Morgen fegte ein eisiger Ost die Wolkenkapuzen von den Berghäuptern. Wie Schären aus dem Meer, ragten die Granitkegel aus den nebelgefüllten Taleinschnitten. Wir folgten für eine Weile einem Steig, querten dann nach rechts in eine Ginsterhalde und erreichten die Quellbäche des Maceiras.
Wir entdeckten unter einer einsamen Huteiche einen aus Felsplatten und Grasplacken zusammengebauten Hirtenunterstand, in den man nur kriechend Einlaß fand, und nahmen ihn zum Nachtlager. Am nächsten Morgen fegte ein eisiger Ost die Wolkenkapuzen von den Berghäuptern. Wie Schären aus dem Meer, ragten die Granitkegel aus den nebelgefüllten Taleinschnitten. Wir folgten für eine Weile einem Steig, querten dann nach rechts in eine Ginsterhalde und erreichten die Quellbäche des Maceiras.
![]() Hier gerieten wir in jene wilden Eichen-Urwälder, deretwegen das Gelände 1970 zum Nationalpark erklärt wurde. Bevor wir in die Waldschlucht abstiegen, erfreuten wir uns noch am lebhaften Treiben der flinken Mauereidechsen und der blau-gelb-smaragdgrünen Schönheit der Wassereidechse. In den Gumpen der Bäche raspelten die Quappen des Iberischen Frosches an Algenfäden, übten sich die schwarz-grün genetzten Marmormolche in ihren Hochzeitsspielen, und unter einer Felsplatte fanden wir den Goldstreifensalamander: schlangenschlank, mit Schleuderzunge und einem nach Eidechsenart abwerfbaren Schwanz.
Hier gerieten wir in jene wilden Eichen-Urwälder, deretwegen das Gelände 1970 zum Nationalpark erklärt wurde. Bevor wir in die Waldschlucht abstiegen, erfreuten wir uns noch am lebhaften Treiben der flinken Mauereidechsen und der blau-gelb-smaragdgrünen Schönheit der Wassereidechse. In den Gumpen der Bäche raspelten die Quappen des Iberischen Frosches an Algenfäden, übten sich die schwarz-grün genetzten Marmormolche in ihren Hochzeitsspielen, und unter einer Felsplatte fanden wir den Goldstreifensalamander: schlangenschlank, mit Schleuderzunge und einem nach Eidechsenart abwerfbaren Schwanz.
![]() Auf dem kaum einen Kilometer langen Abstieg mussten wir uns jeden Meter erkämpfen. Bald versanken wir in moosüberwucherten Felsspalten, im Mulm verrotteter Eichenstämme, zwängten uns durch wildes Baumheide- und Erdbeerbaumgestrüpp; bald zwangen uns Felsabstürze mit niederstäubenden Wasserfällen zu unerwarteten Umwegen, und als einsetzender Regen die Bodenhaftung um ein vielfaches verminderte, glichen wir unser Tempo an jenes der aus allen Spalten auftauchenden Schnecken an. Und dennoch bereitete es uns ein ungemeines Vergnügen, nach den vielen Tagen voll Sonne und Landschaftsweite, uns durch den geheimnisvollen, dämmergrünen, beengten Raum des Waldes zu tasten; wo alle Farben und Töne wie gedämpft eingefangen sind, wo allen Düften der feine Modergeruch des Waldbodens anhaftet. Triefend nass erreichten wir nach vier Stunden am Rand einer Bergwiese ein mächtiges Felsendach, unter dem wir uns gleich häuslich niederließen. Trotz gewechselter Kleidung blieb alles feucht. Überall rauschte, tropfte und gluckste es. Die epiphytenüberwucherten Eichen hüllten sich in Nebelktutten. In der Wunschschmiede unserer blühenden Phantasie loderte ein wärmendes Feuer. Der Atlantik ist eben nicht mehr weit, und mit 3000 mm Jahresniederschlag befanden wir uns hier in einem der regenreichsten Gebiete Europas. Mit Einbruch der Dämmerung erhielten wir Besuch in Form einer Erdkröte, und beim piano des Konzerts der Glockenfröschchen nahm uns Bruder Schlaf in seine Arme.
Auf dem kaum einen Kilometer langen Abstieg mussten wir uns jeden Meter erkämpfen. Bald versanken wir in moosüberwucherten Felsspalten, im Mulm verrotteter Eichenstämme, zwängten uns durch wildes Baumheide- und Erdbeerbaumgestrüpp; bald zwangen uns Felsabstürze mit niederstäubenden Wasserfällen zu unerwarteten Umwegen, und als einsetzender Regen die Bodenhaftung um ein vielfaches verminderte, glichen wir unser Tempo an jenes der aus allen Spalten auftauchenden Schnecken an. Und dennoch bereitete es uns ein ungemeines Vergnügen, nach den vielen Tagen voll Sonne und Landschaftsweite, uns durch den geheimnisvollen, dämmergrünen, beengten Raum des Waldes zu tasten; wo alle Farben und Töne wie gedämpft eingefangen sind, wo allen Düften der feine Modergeruch des Waldbodens anhaftet. Triefend nass erreichten wir nach vier Stunden am Rand einer Bergwiese ein mächtiges Felsendach, unter dem wir uns gleich häuslich niederließen. Trotz gewechselter Kleidung blieb alles feucht. Überall rauschte, tropfte und gluckste es. Die epiphytenüberwucherten Eichen hüllten sich in Nebelktutten. In der Wunschschmiede unserer blühenden Phantasie loderte ein wärmendes Feuer. Der Atlantik ist eben nicht mehr weit, und mit 3000 mm Jahresniederschlag befanden wir uns hier in einem der regenreichsten Gebiete Europas. Mit Einbruch der Dämmerung erhielten wir Besuch in Form einer Erdkröte, und beim piano des Konzerts der Glockenfröschchen nahm uns Bruder Schlaf in seine Arme.
![]() Das Morgenbad in einem der Talkessel des Baches währte zwar nicht lange, vertrieb aber nachhaltig jeden Anflug von Trägheit aus den Gliedern. Als wir zu unserem Felsen zurückkehrten, wärmte sich in den ersten Sonnenstrahlen eine prächtige Stülpnasenotter, blitzende Tautropfen auf dem Schuppenkleid. Sie hatte Glück! Wären wir Hirten gewesen, hätte längst ein Stockhieb ihr Leben ausgelöscht. Getrocknete Otternköpfe werden für 1000 Escudos (ca. 10 DM) verkauft und als Unglück bannendes Zaubermittel in die Schulterpolster derer genäht, die ihr Heimatdorf für immer oder zeitweise verlassen (Emigranten, Militärbedienstete). Als wir eben aufbrechen wollen, hält uns noch ein unvergeßliches Bild gefangen: Farnkrautwedel in der Mähne tritt ein Wildpferdhengst, gefolgt von einigen Stuten, auf die Lichtung.
Das Morgenbad in einem der Talkessel des Baches währte zwar nicht lange, vertrieb aber nachhaltig jeden Anflug von Trägheit aus den Gliedern. Als wir zu unserem Felsen zurückkehrten, wärmte sich in den ersten Sonnenstrahlen eine prächtige Stülpnasenotter, blitzende Tautropfen auf dem Schuppenkleid. Sie hatte Glück! Wären wir Hirten gewesen, hätte längst ein Stockhieb ihr Leben ausgelöscht. Getrocknete Otternköpfe werden für 1000 Escudos (ca. 10 DM) verkauft und als Unglück bannendes Zaubermittel in die Schulterpolster derer genäht, die ihr Heimatdorf für immer oder zeitweise verlassen (Emigranten, Militärbedienstete). Als wir eben aufbrechen wollen, hält uns noch ein unvergeßliches Bild gefangen: Farnkrautwedel in der Mähne tritt ein Wildpferdhengst, gefolgt von einigen Stuten, auf die Lichtung.
![]() Auf einem Steig erreichen wir ein schmales Sträßchen, das einem Bergbach folgt, und wandern zum Rio Homem, einem jener unseligen Orte, die in sogenannten Alternativreiseführern, den Anpreisern „letzter Paradiese“, zu finden sind. Im Sommer führt das Bachbett hier mehr Menschenmassen als Wasser.
Wir nehmen unseren Weg über die Serra Amarela nach Lindoso, einem Dorf, das vor zwanzig Jahren noch am Ende der Welt träumte. Heute ist hier die Landschaftssubstanz mit Hilfe von EU-Geldern durch den Bau eines Stausees und einer überdimensionierten Straße zerstört; und dies inmitten eines Nationalparks. Da uns unsere müden Knochen für solches Gelände zu schade waren, ließen wir uns mit einem Taxi nach Soajo hinüberfahren. Dort machten wir uns in einer der vielen windschiefen, nicht mehr bewohnten Hütten, die sich in die Berghänge ducken, ein Nachtlager zurecht. Es war eine jener urtümlichen Ruinen, der die üppigen Flechtenbärte und Efeuranken wie wirre Haarsträhnen über das Gesicht hingen. Ihre rechtmäßigen Besitzer – Scharen von Ratten und Mäusen und eine Igelfamilie – straften uns leider mit einer wenig erquicklichen Nacht.
Auf einem Steig erreichen wir ein schmales Sträßchen, das einem Bergbach folgt, und wandern zum Rio Homem, einem jener unseligen Orte, die in sogenannten Alternativreiseführern, den Anpreisern „letzter Paradiese“, zu finden sind. Im Sommer führt das Bachbett hier mehr Menschenmassen als Wasser.
Wir nehmen unseren Weg über die Serra Amarela nach Lindoso, einem Dorf, das vor zwanzig Jahren noch am Ende der Welt träumte. Heute ist hier die Landschaftssubstanz mit Hilfe von EU-Geldern durch den Bau eines Stausees und einer überdimensionierten Straße zerstört; und dies inmitten eines Nationalparks. Da uns unsere müden Knochen für solches Gelände zu schade waren, ließen wir uns mit einem Taxi nach Soajo hinüberfahren. Dort machten wir uns in einer der vielen windschiefen, nicht mehr bewohnten Hütten, die sich in die Berghänge ducken, ein Nachtlager zurecht. Es war eine jener urtümlichen Ruinen, der die üppigen Flechtenbärte und Efeuranken wie wirre Haarsträhnen über das Gesicht hingen. Ihre rechtmäßigen Besitzer – Scharen von Ratten und Mäusen und eine Igelfamilie – straften uns leider mit einer wenig erquicklichen Nacht.
Minho
![]() Am nächsten Tag ließen wir die wilde, karge Bergwelt von Trás-os-Montes Hinter uns und wanderten hinab nach Minho, der grünen, lieblichsten Provinz Portugals. Das ganze Land ist hier wie ein von Weingärten und Lauben durchwirkter großer Park. Überall plätschern Quellen in Brunnenbecken, ziehen sich Maisterrassen und Obstbaumhaine die Hänge hinauf. Immer wieder treffen wir auf girlandengeschmückte Dorfstraßen, auf romarias. Das sind Wallfahrten zu Ehren eines Heiligen zu irgendeiner Kapelle, die überall in den Gebirgen verstreut stehen. In der katholischen Frömmigkeit dieser Menschen dominiert ja ein naturhaft-heidnisches Element. Jedes Dorf betrachtet seine Heiligen als compadre, als direktes Familienmitglied, das sich eines stets sorgsam gepflegten Hausaltares erfreuen darf, dem man besonders auf Wallfahrten seine Bitten vorträgt, dem man sich für erfüllte Wünsche durch ein Opfer erkenntlich zeigt, dem man wohl auch einmal flucht, mit dem man sich aber spätestens im anschließenden Volksfest wieder versöhnt. Hier herrscht der Frohsinn mit Spiel und Tanz, mit Hausbesuchen der Alten, mit den erregenden Begegnungen der Jugend in Heuhütten und im nischenreichen Terrain der Macchia. Ganz anders als sein transmontanischer Bruder aus dem Gebirge, spiegelt der Minhoto in einem Leben voller Lieder und Feste die Lieblichkeit seiner Landschaft.
Am nächsten Tag ließen wir die wilde, karge Bergwelt von Trás-os-Montes Hinter uns und wanderten hinab nach Minho, der grünen, lieblichsten Provinz Portugals. Das ganze Land ist hier wie ein von Weingärten und Lauben durchwirkter großer Park. Überall plätschern Quellen in Brunnenbecken, ziehen sich Maisterrassen und Obstbaumhaine die Hänge hinauf. Immer wieder treffen wir auf girlandengeschmückte Dorfstraßen, auf romarias. Das sind Wallfahrten zu Ehren eines Heiligen zu irgendeiner Kapelle, die überall in den Gebirgen verstreut stehen. In der katholischen Frömmigkeit dieser Menschen dominiert ja ein naturhaft-heidnisches Element. Jedes Dorf betrachtet seine Heiligen als compadre, als direktes Familienmitglied, das sich eines stets sorgsam gepflegten Hausaltares erfreuen darf, dem man besonders auf Wallfahrten seine Bitten vorträgt, dem man sich für erfüllte Wünsche durch ein Opfer erkenntlich zeigt, dem man wohl auch einmal flucht, mit dem man sich aber spätestens im anschließenden Volksfest wieder versöhnt. Hier herrscht der Frohsinn mit Spiel und Tanz, mit Hausbesuchen der Alten, mit den erregenden Begegnungen der Jugend in Heuhütten und im nischenreichen Terrain der Macchia. Ganz anders als sein transmontanischer Bruder aus dem Gebirge, spiegelt der Minhoto in einem Leben voller Lieder und Feste die Lieblichkeit seiner Landschaft.
![]() Vier Tage ziehen wir so durchs Land, über die Serra d’Arga zur Serra da Santa Luzia. Hier legen wir uns nochmals zwischen die Felsen. Die Sonne steht im Zenit. Es ist totenstill. Nur die aufspringenden Ginsterschoten knacken. Und doch liegt der Hauch eines Tones im Äther, der nicht weichen will; und die Luft hat eine seidige Weichheit, die dem Bergwind fehlt. Längst kündigt sie sich an, bevor sie hinter einem Felskopf plötzlich vor uns aufleuchtet: die unendliche Silberscheibe des Ozeans.
Vier Tage ziehen wir so durchs Land, über die Serra d’Arga zur Serra da Santa Luzia. Hier legen wir uns nochmals zwischen die Felsen. Die Sonne steht im Zenit. Es ist totenstill. Nur die aufspringenden Ginsterschoten knacken. Und doch liegt der Hauch eines Tones im Äther, der nicht weichen will; und die Luft hat eine seidige Weichheit, die dem Bergwind fehlt. Längst kündigt sie sich an, bevor sie hinter einem Felskopf plötzlich vor uns aufleuchtet: die unendliche Silberscheibe des Ozeans.
![]() O mar – das Meer – und was jenseits von ihm liegt – das war bis zum Beitritt zur EU (1986) die eigentliche Heimat und Sehnsucht des großen Seefahrervolkes der Portugiesen. Der ganze Reichtum und Glanz dieser Nation, besser gesagt ihrer Küstenbewohner, ist verwoben mit dem Meer. An ihm hatten die Bergbewohner nie Anteil. Sie waren der Inbegriff für Beschränktheit, Rückstand und Armut.
O mar – das Meer – und was jenseits von ihm liegt – das war bis zum Beitritt zur EU (1986) die eigentliche Heimat und Sehnsucht des großen Seefahrervolkes der Portugiesen. Der ganze Reichtum und Glanz dieser Nation, besser gesagt ihrer Küstenbewohner, ist verwoben mit dem Meer. An ihm hatten die Bergbewohner nie Anteil. Sie waren der Inbegriff für Beschränktheit, Rückstand und Armut.
![]() Unten, hinter dem bewegten Brandungsstreifen und den gelben Dünenketten liegt das Städtchen Viana do Castelo. In vielen Kehren geht es zu Tal. Fast vier Wochen waren wir in den Bergen, und doch klimpern am Rucksack nicht die Zacken von Steigeisen aneinander, verzeichnet das Gipfelbuch weder Zuwachs noch Stempelbeweise. Dafür hat uns ein Land mit der Natur und den Menschen seiner Bergwelt weit seine Seele geöffnet und die unsere reicher gemacht.
Unten, hinter dem bewegten Brandungsstreifen und den gelben Dünenketten liegt das Städtchen Viana do Castelo. In vielen Kehren geht es zu Tal. Fast vier Wochen waren wir in den Bergen, und doch klimpern am Rucksack nicht die Zacken von Steigeisen aneinander, verzeichnet das Gipfelbuch weder Zuwachs noch Stempelbeweise. Dafür hat uns ein Land mit der Natur und den Menschen seiner Bergwelt weit seine Seele geöffnet und die unsere reicher gemacht.
![]() Manchmal, wenn weniger behagliche Lebensabschnitte uns mit Tristesse und Stürmen belästigen und wir nach Lichtpunkten und Ankerplätzen Ausschau halten, finden wir in der Erinnerung an unsere «doença da serra» immer wieder zu einem Lächeln zurück.
Manchmal, wenn weniger behagliche Lebensabschnitte uns mit Tristesse und Stürmen belästigen und wir nach Lichtpunkten und Ankerplätzen Ausschau halten, finden wir in der Erinnerung an unsere «doença da serra» immer wieder zu einem Lächeln zurück.

|
| Portugal-Post Nr. 11 / 2000 |

|
In den nördlichen Bergen Portugals. Foto aus den 50erJahren. |

|
Sirvozelo (Paradela) in den 50er Jahren |
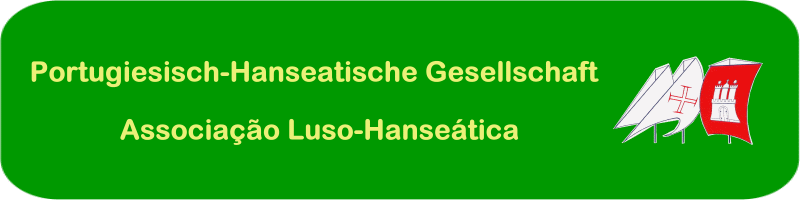 .
.